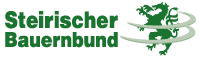Auf 14 steirischen Almen befreien rund 500 freiwillige Helfer die Almen von Farnen, Stauden und Gehölzen. Damit werden sie vor einer drohenden Verbuschung und Verwaldung geschützt. Gleichzeitig haben Landwirtschaftskammer und Almwirtschaftsverein die Info-Offensive „Kommt der Wolf, geht die Alm“ gestartet. Auf 300 Almhütten sind solche Transparente affichiert.
Schwendtag am 15. Juli: Freiwillige Helfer kamen zur Almpflege. Landwirtschaftskammer und Steirischer Almwirtschaftsverein haben für den 15. Juli 2023, freiwillige Helfer eingeladen, um steirische Almen von Farnen, Stauden und Gehölzen zu befreien und sie vor Verbuschung und Verwaldung zu schützen. Ohne Pflege würden jährlich 1000 Hektar Almen verbuschen. Wie in den vergangenen Jahren werden an den sogenannten Schwendtagen (Almpflegetage) auch heuer mehr als 500 freiwillige Helfer auf 14 steirischen Almen Hand anlegen, um die Landschaft offen zu halten und für den Tourismus weiterhin so attraktiv zu halten.
Titschenbacher: Leistungen der Almbauern sind grob unterschätzt – Ohne Almpflege würden jährlich 1.000 Hektar Almen verschwinden. Almpflege würde der öffentlichen Hand 60 Millionen Euro kosten. Die rund 5.400 Almbauern und Almauftreiber verhindern, dass die für den Tourismus so wichtigen Almen, die Berggebiete und die benachteiligten Gebiete verbuschen, verwildern und verwalden. Auf den rund 38.000 Hektar steirischen Almfutterflächen weiden in den Sommermonaten knapp 43.000 Rinder, 900 Pferde sowie 6.800 Schafe und Ziegen. „Ohne die wichtige Almpflege würden jährlich allein in der Steiermark rund 1.000 Hektar wertvolle Almflächen verwalden“, gibt Titschenbacher zu bedenken. Und er rechnet vor: „Würden die Almbauern, die für den steirischen Tourismus so wichtigen Almen, nicht pflegen, käme das dem öffentlichen Budget sehr teuer: Die Almpflege würde der öffentlichen Hand jährlich rund 60 Millionen Euro kosten.“
Almen sind Paradies für Erholungssuchende und Urlauber, für Almbauern ist Bewirtschaftung aber sehr herausfordernd. Der Klimawandel bringt auch die Almwirtschaft aus dem Gleichgewicht: Wetterkapriolen, Vegetationsveränderungen, längere Bewirtschaftungsperioden, ein höherer Bedarf an Tieren sowie Personalmangel sind jene Herausforderungen, die den heimischen Almbauern besonders zu schaffen machen. Ausgesprochen besorgt sind die Almbauern aber wegen der Rückkehr des Raubtieres Wolf, der die gesamte Almwirtschaft in Gefahr bringt.
Informationskampagne: Kommt der Wolf, geht die Alm. Äußerst angespannt ist die Stimmung unter den Almbauern und Almauftreibern wegen der vermehrten Wolfsrisse. Die bange Frage dabei ist, so Kammerpräsident Franz Titschenbacher: „Werden die Tiere den Almsommer heil überstehen?“ Zur vom Land Steiermark geplanten Wolfsverordnung – in anderen Bundesländern wie Nieder- und Oberösterreich oder Kärnten sind solche Verordnungen bereits in Kraft – verlangt Titschenbacher: „Diese muss ehestmöglich umgesetzt und praktikabel und unbürokratisch gestaltet werden.“ Die Almbauern machen ihre diesbezüglichen Sorgen und den Druck, der auf sie lastet, auch mit der Informationskampagne „Kommt der Wolf, geht die Alm“ aufmerksam. 300 Transparente und Plakate hängen steiermarkweit auf und in Almhütten sowie im freien Almgelände. Initiatoren sind Landwirtschaftskammer, Almwirtschaftsverein sowie Schaf- und Ziegenzuchtverband.
Klimawandel verlängert Almsaison. Der Klimawandel ist auch auf den Almen angekommen: Durch die zunehmende Hitze und die Verlängerung der Almsaison steigt zwar der Futterertrag, die Schattenseite ist jedoch, dass mehr Tiere auf den Almen gebraucht werden, um das größere Futterangebot auch zu fressen. Anton Hafellner, Obmann des steirischen Almwirtschaftsvereins erläutert: „Bei größerem Futterangebot können die Tiere die Almen nicht mehr abgrasen. Die Folgen: Das Naturjuwel Almen verbuscht beziehungsweise verwaldet.“ Die Gefahr droht, dass viele Almweiden zuwachsen und die wunderschöne Almlandschaft nicht mehr offengehalten werden kann. Also Alm sucht Tier!
Gefahr der Verwaldung und Verbuschung. Insbesondere der Klimawandel mit den wärmeren Temperaturen wirkt sich auf den Bewuchs stark aus. Die Waldgrenze steigt jährlich an und einzelne Pioniere wie Lärchen oder Latschen sind bereits auf Seehöhen über 2.100 Meter anzutreffen. Damit kann je nach Region die Verwaldung und Verbuschung zwischen zwei bis fünf Prozent der Almflächen pro Jahr voranschreiten. Bei einer fehlenden Pflege beanspruchen Zwergsträucher, wie die Schwarz- oder Heidelbeere, der Almrausch oder der Wacholder (Kranewitt) sowie die Latschen und Erlen, die wertvollen Almflächen für sich.
Zahlen und Fakten. Die Steiermark hat eine Almweidefläche von 38.000 Hektar. Die Almen sichern somit in den Sommermonaten die Futterversorgung von rund 50.000 Wiederkäuern – 43.000 Rinder, davon 12.000 Mutterkühe, 800 Milchkühe, 6.200 Schafe, 600 Ziegen und 900 Pferde. In der Steiermark kümmern sich 911 Hirten, Sennerinnen und Senner um das Wohl der Tiere. Unterschieden wird zwischen Hoch-, Mittel- und Niederalmen. Insgesamt gibt es in der Steiermark 1.642 aktive Almen.
Foto: Fischer